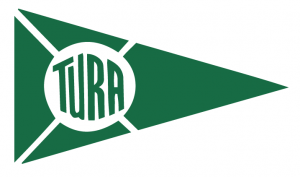Mein größtes Paddelabenteuer
Er ist kein Turaner aber mit seinem weit gereisten Faltboot ein häufiger und gern gesehener Gast bei uns. Wer ihn kennt, schätzt seine freundliche, zugewandte Art und die lebendig erzählten, spannenden Geschichten, in denen sein auf über 55.000 Faltbootkilometern erworbenes, lexikalisches Kajak-Wissen mitschwingt: JAN. Meiner Bitte, einige seiner Abenteuer zu Papier zu bringen, kam er dankenswerterweise hiermit nach. Weitere Berichte sollen folgen…
„In den Sommerferien 1957 wollt & durfte ich mit meinem Freund Wolfgang für drei Wochen nach Wangerooge. Dort konnte für 50 Pfennig pro Nacht neben der Jugendherberge gezeltet werden. Tagesraum und sanitäre Anlagen standen uns offen, warme Mittagsmahlzeiten für eine Mark fünfzig konnten am Vorabend bestellt werden. Damit waren elterliche Sorgen um unser Wohlergehen auszuräumen gewesen.
Am ersten Feriensonntag sollte die Reise morgens um sieben Uhr beginnen. Die Fahrkarte nach Carolinensiel wollten wir erst unmittelbar vor der Abreise kaufen, und so verabredeten wir uns für die gemeinsame Straßenbahnfahrt zum Bahnhof. Mit dem Zeltgepäck so weit zu laufen, erschien uns kein guter Anfang. Allein das Zelt wog rund zehn Kilogramm. Kochgeschirr (fürs Frühstücksmüsli) und Feldflaschen waren aus Aluminium, nachts sollten uns schwere wollene Schlafsäcke warm halten; all das stammte aus Militärbeständen – kurzum, unsere Rucksäcke waren gewaltig schwer.
Am vereinbarten Treffpunkt empfing mich Wolfgang dann aber mit noch einem weiteren Rucksack und einem langen, in eine Zeltbahn gewickelten Paket: seinem Faltboot.
Das war bei den mit den Eltern erörterten Reiseplänen nicht einmal andeutungsweise erschienen, und so war ich dann doch etwas überrascht. Wolfgang hatte von seinem Patenonkel zur Konfirmation ein nigelnagelneues Faltboot bekommen, einen Marquardt-Langzweier, und damit hatten wir vom Bootshaus an der Munte aus schon etliche Touren auf Kuhgraben, Wümme, Lesum und Unterweser gemacht.
Irgendwie erschien mir nun aber die Anwesenheit des Bootes ganz plausibel – Wangerooge war schließlich eine Insel, und mit „dem Meer“, insbesondere der Deutschen Bucht, glaubte ich mich sehr gut auszukennen. Seekarten, See- & Wetterzeichen, Gezeiten, Kurse, Strom- & Windversatz, all das war mir wegen der Inanspruchnahme als Repetitor durch den Nachbarn Jürgen, der als Offiziersanwärter zur See fuhr, etwa so geläufig wie Schuhe zubinden.
Auf unseren Unterwesertouren hatte es reichlich Gelegenheit gegeben, Wolfgang mit meinen Kenntnissen zu beeindrucken. In der Straßenbahn eröffnete mir Wolfgang dann, dass wir ja auch statt nach Wangerooge genauso gut nach Helgoland fahren könnten; er hätte sogar schon die für zwei Personen gültige Fahrkarte für einen Tagesausflug. Die sonntäglichen Tagesfahrten nach Helgoland waren erst kürzlich wieder aufgenommen worden und sehr beliebt. Ich muss ihn wohl fragend angesehen haben. „Gestern Abend gewonnen“, grinste er, „war der erste Preis der Tombola.“. Wolfgang ist vier Jahre älter als ich und war etwa gleich groß. Er für sein Alter eher klein und dabei sehr drahtig, ich für meins sehr lang und schlaksig. Wolfgang war, wie das damals hieß: Lehrling in einem großen Handelshaus mit Lagerhäusern am Hafen, Kontor in der Innenstadt und Niederlassungen in Australien, Neuseeland und Südafrika. Beim alljährlichen Sommerfest der Firma mit Tanz und Tombola hatte er die Fahrkarte nach Helgoland gewonnen. Wir fuhren also gratis zunächst nach Bremerhaven zum Columbusbahnhof, dem gegenüber sonst die Schiffe für die Auswanderer an der Kaje lagen, und dann weiter mit dem Bäderschiff nach Helgoland. Für die anderen Passagiere hatten wir keinen Blick, wir waren mit unserem Gepäck und mit Essen beschäftigt. Zuhause frühstücken hatten wir beide nicht können. Rückblickend erscheint es mir fast wie ein Wunder, dass wir nicht schon im Zug zu essen begonnen hatten.
Die Überfahrt bei blauem Himmel und ruhiger See bot ersten Überlegungen Raum, was denn auf Helgoland, genauer: der Düne, auf der der Zeltplatz lag, mit dem Faltboot zu machen sein würde? Rund um die Düne? Oder die „Große Acht“ rund um Insel und Düne vielleicht? Dafür müsste das richtige Zeitfenster innerhalb einer Tide oder rund um den Tidenkipp passen, aber wo würde es die benötigten Informationen geben? Am ehesten am Hafen von Helgoland. Ach ja: wäre das denn überhaupt erlaubt? Bei solchen Betrachtungen verging die Zeit. Ob ich auch mal aufs Wasser oder in den Himmel geguckt habe? Daran kann ich mich nicht mehr erinnern.
Vor Helgoland ging die Fähre auf Reede vor Anker. Die Helgoländer Börteboote fuhren zunächst die Düne, und danach erst die Insel an. Wir ließen uns zur Düne versetzen. Dort wollten wir zelten und mit dem Bäderschiff „irgendwann“ zurückfahren. Das war mit der Fahrkarte problemlos möglich, weil Hin- und Rückfahrt gesondert gelocht wurden.
Der Campingplatz war wohl erst in einem der Vorjahre angelegt worden. Später Hecken bilden sollende Sträucher waren gepflanzt, es gab eine auch von den Badegästen zu nutzende Baracke mit Umkleideräumen und Plumpsklos, einem Wasserhahn mit Waschbecken und einer Freiluftdusche mit Süßwasser daran. Der Platzwart kam morgens mit dem ersten Boot und fuhr abends mit dem letzten zurück auf die Insel. Für ihn gab es eine winzige Holzbude mit einem verglasten Schaukasten daran. Darin eine nach Osten und Süden bis zum Festland reichende Seekarte mit der Gezeitentabelle und dem aktuellen Wetterbericht daneben.
Beim Zeltaufbau bedeckten wir das Bootsgerüst mit der Bodenplane, denn der strandnahe Platz war ziemlich belebt, und auf neugierige Fragen der Tagesausflügler hatten wir überhaupt keine Lust. Die kümmerten sich aber gar nicht um uns, denn sie hatten es eilig. Juchzend rannten sie kurz ins Meer, duschten anschließend mit Süßwasser, sonnten sich danach noch ein wenig, und
dann mussten sie sich schon wieder umziehen, um rechtzeitig wieder an Bord der Fähre nach Bremerhaven zu kommen. Bis zur Abfahrt des letzten Börteboots übrig blieben außer dem Platzwart einige junge Frauen. Krankenschwestern, wie wir erfuhren, die ihren Urlaub im Erholungsheim des Roten Kreuzes verbrachten. Unser Boot lag unaufgebaut im Zelt; Anlass für verfängliche Fragen bot es so nicht.
Nachts waren wir ganz allein auf der Düne. Bei der Ankunft bestand unser Lebensmittelvorrat aus einigen Frikadellen und Schwarzbrotstullen, einem Päckchen Tee, etwa zwei Kilo Haferflocken, Zucker und einer Erbswurst. Die hieß wirklich so. Sie enthielt in einer weißen Papierhülle ein grünliches Pulver das, nachdem in kochendes Wasser gerührt, eine nahrhafte & wohlschmeckende Mahlzeit ergeben sollte. Wirklich sättigend wurde sie für uns aber erst durch die Zugabe von Haferflocken.
Morgens war unser erster Gang zur Platzwartbude: wie wird das Wetter? Am zweiten Tag war klar, dass wir eine der damals häufigen, oft über Wochen stabilen Hochdruckwetterlagen hatten, und ein Wetterumschwung vorerst nicht zu erwarten war. Am dritten Tag, das Boot lag noch immer zerlegt im Zelt, erörterten wir die Frage, ob es bei diesen Wetterbedingungen nicht ganz gut möglich sein sollte, mit dem Faltboot nach Wangerooge zu paddeln? Schon am Nachmittag waren wir zunehmend sicher, dass solche Faltbootfahrt nicht bloß allgemein, sondern auch uns beiden ziemlich gefahrlos möglich sein müsste.
Nur den Kurs müssten wir wissen, schließlich galt es ja, sich außerhalb der Fahrwasser von Elbe und Weser zu halten. Außer meinem mit Öl gefüllten Marschkompass hatte ich mein Seekarten-Dreieck, ein Geschenk von Jürgen, mitgenommen. Mit einem von Wolfgang zwischen Helgoland und Wangerooge auf der Scheibe über der Karte an der Platzwartbude straff gehaltenen Stück Schnur und dem Dreieck bestimmte ich so gut wie möglich den Kurs. Wind, der uns hätte versetzen können, war weder angesagt, noch zu erwarten – die Chancen für eine mühe- und gefahrlos zu bewältigende Überfahrt waren, nach allem, was wir an Informationen hatten, verlockend groß. Sollten wir es wagen? Wir guckten uns fragend an. Wir wollten es!
Am frühen Nachmittag des vierten Tages ging Wolfgang zum Platzwart, um unseren bisherigen Aufenthalt zu bezahlen „damit wir den Überblick über unser Geld behalten, bevor wir morgen einkaufen gehen. Vielleicht müssen wir auch morgen schon zurück“. Danach legten wir uns früh schlafen. Der Vollmond weckte uns kurz vor Mitternacht. Sternenklarer Himmel, nur einige Lichter auf Helgoland. Hochwasser würde zwischen drei und vier Uhr sein, und wenn es dann etwa Wellengang gäbe, hatten wir vereinbart, würden wir nicht fahren.
Es gab aber keinen Wellengang, die Nordsee plätscherte ein wenig den Strand entlang. Die Entscheidung war gefallen.
Routiniert bauten wir das Boot auf und verstauten, barfuß im Wasser stehend, das in die Zeltbahnen gewickelte Gepäck darin. Die gefüllten Feldflaschen waren griffbereit, essen hatten wir beide nicht gekonnt. Bei Hochwasser war der Sonnenaufgang schon zu ahnen, der Himmel rötete sich ganz zart als wir losfuhren. Ich saß vorne, paddelte, den Blick auf meinem Kompass. Wir hatten nur eine ungefähre Vorstellung von der vor uns liegenden Entfernung, aber ich war voller Zuversicht, dass wir bis zum nächsten Hochwasser Wangerooge erreicht haben würden.
Nun hieß es also paddeln, paddeln, paddeln; gleichmäßig und ja nicht zu schnell, denn die Kräfte mussten ja bis zum Ankommen reichen. Ich guckte stur nach vorne, behielt die Kompassnadel im Blick, Wolfgang guckte auch nach links und rechts. Einmal hat er sich sogar komplett umgedreht: „Helgoland ist schon weg“, sagte er, und es mag ein bisschen geklungen haben wie: „es gibt keinen Weg zurück“ – aber sicher bin ich mir da nicht mehr.
Es wurde nun schnell immer heller, ringsum gab es nur noch Wasser, das sich ganz leicht auf und ab bewegte. Dann flutete strahlender Sonnenschein herab, das Wasser wurde fast blau, vereinzelt standen weiße Wölkchen am Himmel. Irgendwann schienen backbord voraus weiße, stetig dahin ziehende Wölkchen unmittelbar auf dem Wasser zu schweben, und wenig später tauchten darunter Schiffsaufbauten auf. So viel Wasser macht durstig, das erfuhren wir nun auch. Wir tranken abwechselnd, damit der jeweils andere das Boot auf Kurs halten konnte. Allmählich machte sich auch der Hunger bemerkbar. Trockene Haferflocken, gefühlt endlos im Mund behalten und immer wieder durchgekaut, halfen dagegen. Stunde um Stunde paddelten wir.
Inzwischen waren die verschiedenen Schiffe auch besser zuzuordnen. Immer deutlicher wurde, welche Schiffe aus der Elbe, und welche aus der Weser gekommen waren. Es mag um die Mittagszeit gewesen sein, als wir erste Fischkutter rechts von uns gesehen haben. Leuchttürme, wie etwa den Roter Sand- oder den Alte Weser-Turm gesehen zu haben, kann ich mich ebenso wenig erinnern, wie an eines der damals noch vor Anker liegenden Feuerschiffe. Nachdem wir die ersten Kutter gesehen hatten, dauerte es noch eine ganze Weile, bis die Spitze des alten Leuchtturms auf Wangerooge direkt vor unserem Bug über dem Horizont auftauchte.
Ich erinnere mich noch ganz genau an diesen Moment. Gerade so, als wäre es das Selbstverständlichste von der Welt, stellte ich ganz nüchtern fest, dass der Kurs richtig bestimmt war. Für die Gunst der übrigen Umstände hatte ich absolut kein Gespür. Kurz vor Hochwasser erreichten wir den menschenleeren Strand von Wangerooge.
Das Boot versteckten wir in den Dünen und gingen mit unseren Rucksäcken zur Jugendherberge. Dort wurden wir mit der Ankündigung, dass es abends Bratkartoffeln gäbe, überaus freundlich empfangen. Unser Zelt war rasch aufgebaut, dann legten wir uns schlafen. Erst am nächsten Tag zerlegten wir das Boot, verstauten es wieder im Zelt, dann gingen wir in den Ort, kauften Ansichtskarten und schrieben nachhause, dass es uns auf Wangerooge gut gefiele.
Die restlichen Ferientage verbrachten wir überwiegend faulenzend auf der Insel. Über unser Paddelabenteuer sprachen wir nicht, gerade so, als ob wir ahnten, dass wir riesengroßes Glück gehabt hatten. Einige Tage vor Ende der Ferien schlug das Wetter plötzlich um. Wären wir so lange auf der Helgoländer Düne geblieben, hätten wir unsere Fahrt gewiss nicht gewagt. Während der Überfahrt nach Carolinensiel regnete es. Wegen Starkwinds und heftigen Wellengangs mussten auch wir mit dem vielen, von den anderen Passagieren missbilligend beäugten Gepäck unter Deck. Für die anschließende Zugfahrt kauften wir Fischbrötchen. In Bremen brachten wir zunächst das Boot ins Bootshaus an der Munte, dann erst fuhren wir nachhause.
Die Lebenswege von Wolfgang und mir trennten sich, als er seine Ausbildung bei der australischen Niederlassung der Firma fortsetzte. Erst Jahrzehnte später sind wir uns wieder begegnet und da habe ich von ihm erfahren, dass seine Eltern -ebenso wie meine- nie etwas von unserem Abenteuer erfahren haben. Ein letzter Satz zu mir: ich bin Jahrgang 1945.“
Tolles Abenteur? Schreibe Du Dein größtes Kajak-Abenteur doch auch einmal auf und schicke es uns!
Dies könnte der Anfang einer spannenden Serie sein.
Hinweis der Redaktion: Zur Nachahmung ist diese Tour nur eingeschränkt bzw. mit der entsprechenden Erfahrung empfohlen! ![]()